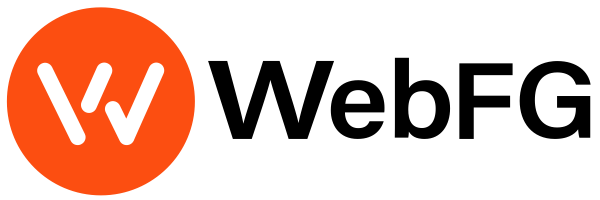Aperçu
Marchés des actions
| Nom | Mon | Actuel | +/- (%) | +/- (%) 2025 | +/- (%) 2025 en CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI | CHF | 12'644.49 | -0.45% | +9.00% | +9.00% |
| SLI Swiss Leader Pr | CHF | 2'035.68 | -0.75% | +6.18% | +6.18% |
| SPI | CHF | 17'361.83 | -0.52% | +12.21% | +12.21% |
| NASDAQ 100 | USD | --- | --- | --- | --- |
| S&P 500 | USD | 6'664.01 | --- | +13.30% | -1.05% |
| DAX | EUR | 23'830.99 | -1.82% | +19.70% | +17.79% |
| CboeEurozone50PREUR | EUR | 577.79 | -0.81% | +17.10% | +15.23% |
| Nikkei 225 | JPY | 47'582.15 | --- | --- | +8.62% |
La bourse n'est pas encore ouverte
La bourse n'est pas encore ouverte