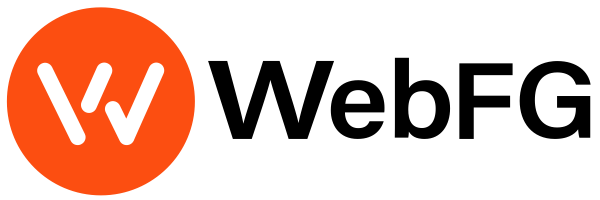News
François Hollande: «Putin kennt nur Machtbeziehungen»
Der ehemalige Präsident Frankreichs glaubt, Putin wird erst auf eine Waffenruhe eingehen, wenn Sanktionen der russischen Wirtschaft unerträglichen Schaden zugefügt haben.
Der Krieg in der Ukraine wütet unablässig. Verschiedene Länder wollen als Vermittler den Konflikt entschärfen, bislang erfolglos. Einer, der schon 2014 versucht hat, mit der Ukraine und Russland eine Lösung zu finden, ist der ehemalige französische Präsident François Hollande. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel war er ein Urheber der Minsker Abkommen, die einen dauerhaften Waffenstillstand und die Grundlagen für einen Befriedungsprozess – damals nur für die Ostukraine – hätten liefern sollen. Im Gespräch erklärt Hollande, wie mit Wladimir Putin umzugehen ist und wie das Minsker Abkommen als Rahmen für neue Verhandlungen dienen könnte.
Herr Hollande, wir sind Zeugen eines Krieges in der Ukraine, einem europäischen Land. Welche Fehler hat Europa gemacht, um in diese Lage zu kommen?
Es gibt nur einen Schuldigen, und das ist Wladimir Putin. Er hat diesen Krieg angezettelt. Es ist seine Armee, die bombardiert, die Zivilisten, Theater und Krankenhäuser angreift. Es ist seine Propaganda, die den Eindruck erweckt, sie seien die Angegriffenen, obwohl der erste Aggressor der russische Präsident ist. Europa wiederum glaubte, dass Handel, Austausch und Dialog ihn davon überzeugen könnten, auf die Wiedererrichtung der ehemaligen Sowjetunion zu verzichten. Und dass er sich nicht dagegen sträuben würde, die Ukraine eines Tages der EU beitreten zu lassen. Ich betrachte diese Haltung zwar als naiv, aber nicht als schuldhaft.
Sie waren einer der Initiatoren des Minsker Abkommens, um eine Lösung für den Konflikt in der Ostukraine zu finden. Das Abkommen hatte schon damals keine Chance.
Doch, es hatte einen Waffenstillstand durchgesetzt und den Grundsatz der territorialen Integrität der Ukraine aufrechterhalten. Sieben Jahre lang hat es gehalten. Es war der Rahmen, in dem der Dialog fortgesetzt wurde. Doch es wurde immer deutlicher, dass Wladimir Putin nicht länger an dem festhalten wollte, was er als Fiktion betrachtete. Durch die Anerkennung der separatistischen Republiken hat er das Minsker Abkommen zerschlagen; aber es könnte wieder zum Rahmen für künftige Verhandlungen werden.
Sie haben mit Wladimir Putin verhandelt, kennen seine Denkweise. Was könnte den russischen Präsidenten heute dazu bewegen, seine Truppen abzuziehen?
Wladimir Putin kennt nur Machtbeziehungen. Er wird nur dann auf einen Waffenstillstand und einen Ausstieg aus dem Konflikt hinarbeiten, wenn die Sanktionen seiner Wirtschaft unerträgliche Schäden zufügen und der ukrainische Widerstand seinen Vorstoss aufhält, wie es heute der Fall ist. Dann wird er versuchen, seine Gewinne einzulösen. Das sollte uns dazu veranlassen, auch nach Einstellung der Kampfhandlungen den Druck aufrechtzuerhalten.
Frankreich hat erfolglos versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln. Können Frankreich und die EU noch eine Rolle in einem Friedensprozess spielen?
Das 2014 entstandene Normandie-Format, das neben Frankreich und Deutschland auch die Ukraine und Russland umfasste, bleibt eine mögliche Form. Doch Putin sucht nun nach anderen Partnern: Israel, die Türkei und China. Nichtsdestotrotz fordern die Ukrainer Garanten für den Friedensprozess: Die EU könnte einer der glaubwürdigsten sein.
Mittelfristig ist eine politische Lösung zwischen Russland und der Ukraine notwendig. Welche Zugeständnisse sollte die Ukraine bereit sein zu machen?
Die Ukraine hat bereits viel getan, indem sie zugestimmt hat, sich nicht mehr um die Nato-Mitgliedschaft zu bewerben und eine Form der Neutralität anzunehmen. Ich erinnere auch daran, dass der Donbass besetzt ist und die Krim in die Russische Föderation eingegliedert wurde. Was Selenski fordert, sind Zusicherungen für die zukünftige Sicherheit und eine Anerkennung der territorialen Integrität der Ukraine.
Welche sicherheitspolitischen Folgen hat der Krieg für Europa? Deutschland hat grosse Investitionen in seine Armee angekündigt. Muss Frankreich nachziehen?
Frankreich unternimmt bereits grosse Anstrengungen zur Modernisierung des Verteidigungsapparats. Es werden dafür mehr als 2% des Sozialprodukts aufgewendet. Frankreich interveniert auch in der Sahelzone. Darüber hinaus unterhält das Land auch Abschreckungskräfte, die glaubwürdig sind. Es ist jedoch wichtig und begrüssenswert, dass sich Deutschland des Rückstands bewusst geworden ist, den es im Bereich der Verteidigung aufweist. Ich wünsche mir, dass die Investitionen, die Deutschland tätigen wird, im Rahmen der Nato mit Frankreich abgestimmt werden.
Braucht Europa eine Armee, die Russland die Stirn bieten kann? Oder reicht das Vertrauen in die Schutzmacht der USA?
Mit dem Irakkrieg wurde die transatlantische Bindung erheblich gestärkt. Joe Biden erinnerte an die Verpflichtung der USA, die Mitglieder des Atlantischen Bündnisses zu schützen, wenn ihre territoriale Souveränität infrage gestellt wird. Aber ist gewiss, dass eines Tages ein anderer US-Präsident die gleiche Position vertreten wird? Auch die Europäer müssen in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen und einen starken Pfeiler innerhalb der Nato zu bilden.
Welche Rolle spielt die Schweiz in einer neuen europäischen Sicherheitsstruktur?
Die Schweiz ist ein neutrales Land, das jedoch erhebliche Anstrengungen für seine Sicherheit unternimmt. Sie steht dem Unglück der Welt und den Konflikten, die sie umgeben, weder gleichgültig noch teilnahmslos gegenüber. Sie spielt eine Vermittlerrolle, wann immer sie darum gebeten wird. Die Schweiz bezieht gleichzeitig klar Stellung zu den Verantwortlichkeiten der einen oder anderen Partei. Das hat sie gezeigt, als sie den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte. Die Nato muss sicherstellen, dass sie die Schweiz regelmässig über ihre Entscheidungen im Bereich der kollektiven Sicherheit informiert.
Frankreich ist für ein Viertel seines Erdgasbedarfs von Russland abhängig. Wie kann man diese Abhängigkeit verringern, ohne die Inflation in die Höhe zu treiben?
Die Inflation war schon vor der Krise in der Ukraine da. Die Energiekosten waren bereits mit der kräftigen Erholung des Wirtschaftswachstums angestiegen. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben diesen Trend noch verstärkt. Die rasche Verringerung der Gaslieferungen aus Russland wird uns dazu veranlassen, unsere Energiequellen zu diversifizieren, das Energiesparen zu fördern, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und auf die Kernenergie zurückzugreifen. Aber es stimmt, es wird Auswirkungen auf die Kaufkraft der Franzosen haben. Daher die Herausforderung, Ungleichheiten zu verringern und Lohnerhöhungen vorzunehmen.
Was sollte – sozial, aber auch wirtschaftspolitisch – zuoberst auf der Agenda des neuen französischen Präsidenten stehen?
Abgesehen von den diplomatischen und militärischen Herausforderungen besteht die erste Aufgabe darin, die Auswirkungen einer nie dagewesenen Inflation in Schach zu halten und die Energiewende zu schaffen. Die zweite Herausforderung besteht darin, nach zwei Jahren gemäss dem Motto «Koste es, was es wolle», in denen die Staatsverschuldung auf 115% des Bruttoinlandprodukts gestiegen ist, wieder ausgeglichenere öffentliche Finanzen zu erreichen. Und schliesslich müssen wir den Reformen in den Bereichen Bildung, Universitäten und Forschung Priorität einräumen, um sowohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als auch den sozialen Zusammenhalt zu fördern.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.