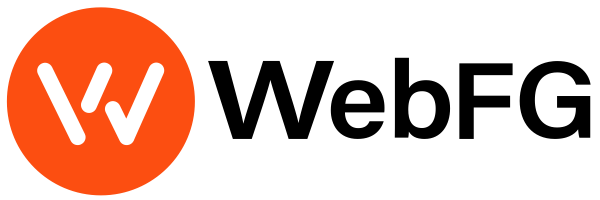News
«Wir brauchen Wettbewerb im Gesundheitswesen»
Stefan Felder, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel, im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» zur Initiative für eine Einheitskrankenkasse.
Am 28. September wird über die Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» abgestimmt. Der Gesundheitsökonom Stefan Felder erklärt im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft», warum eine monopolistische Krankenkasse ökonomisch falsch ist Zur PersonSeit 2011 hält Stefan Felder den Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie (Health Economics) an der Universität Basel. Felder ist ein ausgewiesener gesundheitsökonomischer Experte, er beschäftigt sich seit rund zwanzig Jahren wissenschaftlich mit dieser Thematik. Bevor er nach Basel kam, nahm er entsprechende Professuren an den Universitäten Magdeburg (1997 bis 2008) sowie Duisburg-Essen (2008 bis 2011) wahr. Der aus Sursee stammende Felder hat in Bern Ökonomie studiert und 1985 abgeschlossen. 1989 erwarb er das Doktorat und 1995 die Habilitation für Volkswirtschaftslehre. Nach verschiedenen Assistentenstellen und einem Forschungsaufenthalt in Kanada versah er von 1993 bis 1995 seinen ersten Lehrauftrag an der Universität Freiburg i. Üe. Felder ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.und die Probleme im Gesundheitswesen nicht lösen kann.
Herr Felder, die Befürworter der Volksinitiative argumentieren damit, dass die Kostenexplosion im Gesundheitswesen bekämpft werden müsse. Zuerst stellt sich die Frage, warum diese Kosten stetig steigen.
Der wichtigste Faktor ist die Einkommensentwicklung. Die Gesundheit ist ein spezielles Gut. Wenn die Einkommen um 1% steigen, erhöhen sich die Nachfrage und die Gesundheitskosten um mehr als 1%. Das ist der wichtigste Treiber. Hinzu kommt der technische Fortschritt in Medizin, Therapie und Diagnostik. Die Alterung der Bevölkerung ist kein entscheidender Faktor.
Aber es heisst doch immer, dass ein Grossteil der von einer Person verursachten Gesundheitskosten in den letzten paar Lebensjahren anfällt.
Ja, genau das erklärt, warum die Demografie keine zentrale Rolle spielt. Der Effekt bleibt gleich, ob Sie nun fünf oder zehn Jahre älter werden oder nicht. In der kurativen Medizin spielt die Demografie keine Rolle, in der Langzeitpflege eher. Die Kostensteigerungen lassen sich nicht auf die Demografie abschieben.
Wie weit lassen sich die Kostensteigerungen beeinflussen?
Die Ausgaben sind stark von der Nachfrage geprägt. Bei vielen klassischen Konsumgütern ergibt sich früher oder später eine Sättigung. Wenn die Einkommen weiter steigen, findet eine Verschiebung der Nachfrage eben etwa zur Gesundheit statt. Die Kosten sind nachfragegetrieben und damit nicht Schicksal. Das Gesundheitswesen ist die am stärksten wachsende Branche.
Wie stark fällt der medizinische Fortschritt als Kostentreiber ins Gewicht?
Auch der medizinische Fortschritt fällt nicht vom Himmel, auch er ist letztlich nachfragegetrieben. Sehr wichtig ist im Gesundheitsbereich zudem, dass er sehr personalintensiv ist. Viele Branchen werden stets kapitalintensiver, was die Löhne nach oben treibt. Im Gesundheitssektor sind die Möglichkeiten, Arbeit durch Kapital zu ersetzen, begrenzt.
Die Initiative für eine Einheitskrankenkasse will über ein Monopol in der Krankenversicherung Einfluss auf die Kostenentwicklung nehmen. Ist das vernünftig?
Nein, der Ansatz ist falsch. Dahinter steht eine Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, wonach der Staat eine Versorgungsanstalt organisiert. Er kennt den Bedarf der Bevölkerung und teilt dann Rationen zu. Das ist der Kern des Vorschlags. Die Branche wächst weiter, es ist nicht möglich, mit einem Rezept aus der Vergangenheit Einfluss zu nehmen. Wir brauchen den Wettbewerb im Gesundheitswesen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Staatliche Lösungen tendieren zum Einheitsangebot.
Die Initianten behaupten, der Wettbewerb sei im Gesundheitswesen irrelevant.
Das trifft nicht zu. Zunächst haben wir den Bereich der Zusatzversicherungen. Zudem ist wichtig, dass die Kassen die Möglichkeit haben, Verträge mit den unterschiedlichen Leistungserbringern abzuschliessen. Den Versicherten können unterschiedliche Pakete angeboten werden, da spielt der Wettbewerb.
Die Befürworter verweisen häufig auf die Suva. Sie sei ein Monopol, das funktioniere, das gelte folglich auch für die Krankenversicherung. Stimmt der Schluss?
In der Suva entfallen 31% der Leistungen auf Heilungskosten, der Rest auf Kapitalleistungen. In den Krankenversicherungen sind 100% Heilungskosten. Das zeigt schon, dass der Vergleich hinkt. Mit Blick auf diese Verteilung müsste die Suva geringere Betriebskosten haben als die Krankenversicherer. Zudem haben rund 80% der Bevölkerung in der Krankenversicherung pro Jahr mindestens einen Fall, in der Suva nur etwa 20 bis 25%. Dennoch sind die Betriebskosten in der Suva deutlich höher als in der Krankenversicherung. Das gilt auch im Vergleich mit privaten Unfallversicherern. Das hat damit zu tun, dass die Suva kaum im Wettbewerb steht.
Im Gesundheitswesen ist von reguliertem Wettbewerb die Rede. Welche Bereiche müssen reguliert werden?
Es gibt gute Argumente für ein Obligatorium in der Krankenversicherung. Die Frage ist, wie umfangreich es sein soll. Heute ist das Angebot sehr reichlich. Daneben existieren die Zusatzversicherungen, die mehr ausgebaut werden sollten. Die Ausgangslage in der Krankenversicherung ist kompliziert, weil ein mehrseitiges Verhältnis besteht: Versicherer, Versicherte, Leistungserbringer und der Staat.
Der obligatorische Bereich ist immer ausgedehnt worden. Eigentlich müsste er wieder geschrumpft werden.
Das ist richtig. Es gibt im Krankenversicherungsgesetz den Artikel 32, bekannt unter dem Kürzel WZW, der vorschreibt, dass eine medizinische Leistung aus dem Grundkatalog wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein soll. Das Swiss Medical Board, dem ich angehöre, arbeitet an diesem Punkt. Es ist eine grosse Herausforderung, nach diesen Kriterien den Katalog abzubauen, weil sich Betroffene natürlich stets dagegen zur Wehr setzen werden. Die Pflege des Leistungskatalogs wäre eine wichtige Aufgabe. Allerdings werden fast nur neue Leistungen einbezogen.
Die Befürworter der Initiative werden festhalten, der Ausbau des Leistungskatalogs könne über die Senkung der Verwaltungskosten finanziert werden.
Sie belaufen sich heute auf rund 5% der Prämieneinnahmen. Da ist der Spielraum für Einsparungen gering.
Wären die Verwaltungskosten im Monopol deutlich geringer?
Die Suva mit ihren höheren Verwaltungskosten zeigt, dass das nicht der Fall ist. Der Druck fehlt, die Kosten niedrig zu halten. In privaten Versicherungen müssen sie über die Prämien hereingeholt werden. Wer nicht Acht gibt, straft sich selbst.
Ein weiteres Stichwort unter dem Thema Wettbewerb ist Managed Care. Wäre dies unter einem Monopol noch möglich?
Managed Care ist Teil einer Vielfalt verschiedener möglicher Verträge. Die Frage ist, ob die Einheitskasse einen Anreiz hätte, ein derartiges Angebot zu schaffen. Im Wettbewerb besteht er auf jeden Fall. Grundsätzlich könnte das Modell schon übernommen werden. Die Alternative dazu ist der Selbstbehalt.
Welche Rolle spielt die von den Initianten kritisierte Jagd nach den guten Risiken?
Wo es keine risikoäquivalenten Prämien gibt, wie in der Basisversicherung, entsteht ein Anreiz für die Versicherer, gute Risiken zu versichern. Zunächst braucht es in der Basisversicherung ein Diskriminierungsverbot. Zudem muss ein Risikoausgleich geschaffen werden, damit der Versicherer nicht nur nach guten Risiken sucht. Da stellt sich die Frage, wie weit der Risikoausgleich gehen kann. Er berücksichtigt Alter, Geschlecht und Spitalaufenthalte im Vorjahr. Das reicht nicht, das Parlament will denn auch weiter gehen. Auch chronische Krankheiten sollen neu einbezogen werden. Dieses Problem stellt sich in einer Einheitskasse nicht, da gibt es keine Kassenwechsel.
Wird mit einem immer weiter gehenden Risikoausgleich die Einheitskasse nicht gleichsam durch die Hintertür eingeführt?
Auch mit dem Risikoausgleich hat jede Kasse einen Anreiz, die Kosten zu senken. Aber es entstehen Kosten mit dem Risikoausgleich, er muss organisiert und umgesetzt werden. Wird er zu stark verfeinert, besteht die Gefahr der Manipulation etwa der diagnostischen Informationen.
Was wären die wichtigsten Ansatzpunkte einer wettbewerbsorientierten Reform des Gesundheitswesens?
Es gibt aufseiten der Leistungserbringer unnötige Regulierungen und einengende Bestimmungen in den Vergütungssystemen. In der Krankenversicherungen hingegen besteht eine lange Tradition des Wettbewerbs, jeder kann die Kasse problemlos wechseln. Ein Thema dagegen ist der Vertragszwang – jede Kasse muss die Rechnung jedes Arztes bezahlen. Dieser Zwang müsste aufgehoben werden.
Würde das Kostenwachstum durch eine Annahme der Initiative gedämpft?
Mit einer Einheitskasse hätten wir auf der Nachfrageseite nur noch einen Player, er hätte grosse Marktmacht gegenüber den Leistungserbringern. Man könnte erwarten, dass er die Preise drücken könnte. Kurzfristig könnte ein langsameres Kostenwachstum erwartet werden. Längerfristig dürfte das jedoch zulasten der Qualität gehen. Der Zugang zur medizinischen Versorgung würde zudem leiden.
Aber es hätte kaum mehr jemand einen Anreiz oder ein Interesse, Kosten zu sparen?
Mengenmässig wäre wohl mit einem Anstieg zu rechnen. Die Kosten ergeben sich aus dem Produkt von Preis und Menge, so könnte in der Tat ein Kostenwachstum resultieren. Die Politik hätte ein Problem, wenn die Prämien stetig steigen. Sie sähe sich mit dem Ruf nach einer Eindämmung konfrontiert. In der Folge würde der Zugang zu Leistungen erschwert, Kapazitäten würden abgebaut und Ähnliches mehr.
Oder der Ruf nach einer staatlichen Finanzierung über Steuern?
Ja, das ist denkbar. Das könnte dann zu massiv höheren Steuern führen.
Der Initiativtext sieht vor, dass die Organe der Einheitskasse aus Vertretern von Bund, Kantonen, Leistungserbringern und Versicherten zusammengesetzt werden müssen. Interessenkonflikte wären das Resultat.
Die Initianten haben die Leistungserbringer mit einbezogen, um politischen Sukkurs zu erhalten. Das ist eine strategisch motivierte Fehlkonstruktion. Damit macht man gleichsam den Bock zum Gärtner. Es braucht eine Trennung zwischen Einkäufern und Erbringern von Leistungen, sonst entstehen Interessenkonflikte. Die Patienten haben heute bereits Einfluss, indem sie ihre Kasse wählen und wechseln, sie können so ihren Präferenzen Ausdruck geben. Dass eine institutionalisierte Patientenvertretung die Vielfalt der Interessen der Versicherten spiegeln könnte, ist eine absurde Vorstellung.
Der InitiativtextArt. 117
Abs. 3 (neu) Die soziale Krankenversicherung wird von einer einheitlichen nationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung durchgeführt. Deren Organe werden namentlich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone, der Versicherten und der Leistungserbringer gebildet.
Abs. 4 (neu) Die nationale Einrichtung verfügt über kantonale oder interkantonale Agenturen. Diese legen namentlich die Prämien fest, ziehen sie ein und vergüten die Leistungen. Für jeden Kanton wird eine einheitliche Prämie festgelegt; diese wird aufgrund der Kosten der sozialen Krankenversicherung berechnet.
Ein Ja wäre auch ein ordnungspolitisches Signal?
Ja, ein sehr bedenkliches. Der Gesundheitsbereich wächst stark, er schafft viel Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund wäre eine Einheitskasse, die begrenzend wirkt, schlecht. Hier alles staatlich zu regulieren, halte ich für ein falsches Rezept.
Eine Einheitskasse mit acht Millionen Mitgliedern unter einer zentralen Führung – das ist eine beängstigende Vorstellung.
Acht Millionen Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen stünden einer einzigen Kasse gegenüber. Das gälte auch für die 440 Spitäler, 16 000 Ärzte, 1700 Apotheken, 6300 Physiotherapeuten usw. Alle Leistungserbringer brauchen Verträge, müssen Rechnungen stellen – und auf der Gegenseite steht nur eine Organisation.
Grossbritannien hat ein staatlich gelenktes Gesundheitswesen, den National Health Service NHS. Wie bewährt sich das?
Die Erfahrungen sind schlecht. Immerhin übernimmt Grossbritannien eine Vorreiterrolle im Beschränken des Leistungskatalogs. Wenn ein Staat alles finanziert, muss er sich überlegen, wo die Grenzen sind. Dagegen hat der NHS grosse Problem im Verhältnis zu den Leistungserbringern. Alles liegt beim Staat – er ist überfordert, und die Bevölkerung ist unzufrieden.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.