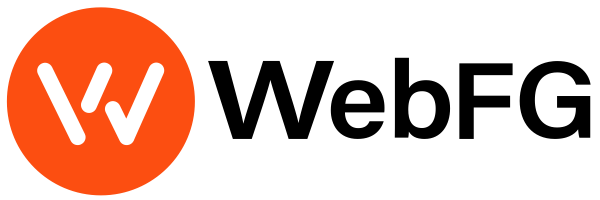News
«Putin hat falsch kalkuliert»
Die renommierte Historikerin Margaret MacMillan hält die russische Invasion der Ukraine für den Wendepunkt in der Geschichte des 21. Jahrhunderts.
Krieg prägt staatliche Institutionen und gesellschaftliche Werte und findet gar Eingang in unsere Sprache und die Kunst. Bewaffnete Konflikte sind eine der wenigen Konstanten der Geschichte der Menschheit, argumentiert Margaret MacMillan. Die Historikerin befasst sich bereits seit dem Beginn ihrer Karriere mit Krieg. Dabei sei es als Kanadierin ihr Vorteil, keiner Grossmacht anzugehören und die Ereignisse objektiver beurteilen zu können. Beim gegenwärtigen russischen Krieg in der Ukraine ist MacMillans Position aber klar: Sie steht auf der Seite des Westens.
Frau MacMillan, was war Ihre Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine?
Ich war geschockt. Wie so viele Beobachter war ich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Putin seine Drohungen nicht in die Tat umsetzen würde, dass er bloss blufft.
Woher kommt diese Fehleinschätzung?
Die Situation erinnert mich an das Jahr 1914, als die Europäer dachten, sie seien sicher vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Diese falsche Sicherheit, dass Krieg etwas ist, was uns nicht betrifft und nur weit weg geschieht, ist verbreitetes Gedankengut in den Staaten, die seit 1945 keinen Krieg mehr auf eigenem Boden erlebt haben. Der Westen – ein ungenügender, aber leider unser einziger Begriff für Europa, die USA, Kanada, Australien und Japan – wiegte sich in Sicherheit.
Vergessen wir die Vergangenheit?
Das menschliche Gedächtnis ist kurz. Aber ich denke, bei diesem Konflikt wird es sein wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser begann erst in den Sechzigerjahren aus dem kollektiven Bewusstsein zu schwinden. Der russische Krieg in der Ukraine wird als Wendepunkt in die Geschichte des einundzwanzigsten Jahrhunderts eingehen.
Weshalb?
Weil er die Tür geöffnet hat für nicht provozierte militärische Angriffe eines Staates auf einen anderen. Zudem denke ich, dass er den Westen wachgerüttelt hat: Unsere Werte sind wichtig, und wir müssen sie beschützen. Und dass man im Umgang mit Autokraten vorsichtig sein muss. Auch wenn die westlichen Sanktionen gegen Russland den Krieg in der Ukraine kurzfristig nicht stoppen werden: Putin wurde von der geeinten Front überrascht. Er dachte, der Westen sei dekadent und handlungsunfähig.
Können Sie das ausführen?
In der Disziplin der Internationalen Beziehungen gibt es die Theorie des Realismus, wonach Menschen rational handeln und rationale Entscheidungen treffen. Die momentane Situation erinnert uns daran, dass Rationalität subjektiv ist: Der Westen ging davon aus, dass Putin bloss Druck aufsetzt, um Zugeständnisse zu gewinnen. Aus Putins Sicht war die Entscheidung zur Invasion hingegen ebenfalls rational, auch wenn dafür viele Russen und Ukrainer sterben müssen.
Putin bezeichnet den Zerfall der Sowjetunion als grösste Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts. Was sagt uns das?
Wirklich eine ausserordentliche Aussage, wenn man bedenkt, wie viele Katastrophen im vergangenen Jahrhundert stattgefunden haben. Putin glaubt, Russland sei der rechtmässige Platz als Grossmacht verwehrt worden. Dabei stützt er sich auf eine weit zurückliegende Vergangenheit, sieht sich als Nachfolger von Peter dem Grossen, der Russland modernisiert und das russische Kaiserreich begründet hatte.
«Der Krieg in der Ukraine hat den Westen wachgerüttelt: Wir müssen unsere Werte beschützen.»
Wie besorgt sollten andere ehemalige sowjetische Staaten sein?
Die Ukraine ist für Putin definitiv der grosse Preis, den es zurückzuerobern gilt. Sein Argument ist, dass die Ukrainer eigentlich Russen sind, auch wenn sie das selbst nicht so sehen. Aber die Sorgen der ehemaligen Sowjetstaaten sind berechtigt. Beispiel Moldau: Russland unterstützt die Unabhängigkeitsbestrebungen Transnistriens, völkerrechtlich klar ein Teil der Republik Moldau. Ebenfalls gefährdet ist Kasachstan, allerdings leben dort mehr als fünfzig Ethnien, viele nicht slawisch. Das könnte Kasachstan schützen, denn Putin ist auch rassisch motiviert: Er will, dass alle Slawen wieder vereint werden.
Was ist mit dem Baltikum und Finnland?
Dort ist die Gefahr weniger akut – aber ich könnte auch falschliegen, wir haben uns in der Vergangenheit schon oft geirrt über Putins Motivation. Allerdings lag auch Putin falsch in der Annahme, seine Armee werde die Ukraine binnen kürzester Zeit einnehmen. Im erbeuteten Gepäck russischer Offiziere fand man Ausgehuniformen: Sie dachten, nach zwei Tagen in der Ukraine sei es Zeit für die Siegesparade.
In dieser Fehleinschätzung war Putin nicht allein. Unabhängige Militärstrategen gingen ebenfalls davon aus, dass die russische Armee der ukrainischen überlegen sei.
Es ist ein menschlicher Instinkt, sich an Nummern festzuhalten. Die Experten haben die Raketen, die Kampfflieger und die Soldaten gezählt – und von allem haben die Russen mehr als die Ukrainer. Was vergessen ging, war einerseits, wie fest sich die ukrainischen Streitkräfte seit 2009 modernisiert haben. Zudem dachten die Russen, sie würden von den Ukrainern mit offenen Armen empfangen – dass sie einen schnellen Angriffskrieg und keine langfristige Belagerung planen müssen.
Welche Rolle spielt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski?
Eine sehr wichtige. Mit seiner Entscheidung, im belagerten Kiew zu bleiben, sendet er ein Signal an die Bevölkerung, ebenfalls tapfer zu bleiben. Viele andere Staatsoberhäupter wären an seiner Stelle geflohen. Zudem ist er ein begabter Kommunikator und vermag die Leute im Land und im Ausland zu überzeugen.
Und erneut stellt sich die Frage: Wer hätte das gedacht?
Genau. Bei seiner Wahl zum Präsidenten 2019 verspottete man ihn in europäischen Zeitungen noch als Clown. Zu Kriegsbeginn stand seine Zustimmungsquote unter einem Drittel, jetzt wird er von mehr als 90% der Ukrainer unterstützt. Er erinnert mich an Winston Churchill, der 1940 im Vereinigten Königreich ebenfalls entgegen den Erwartungen der schwierigen Situation gewachsen war.
Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie Staatsoberhäupter die Geschichte geprägt haben. Was braucht es neben einer starken Persönlichkeit?
Gute Führungsqualitäten allein reichen nicht aus. So hat die Ukraine eine Bevölkerung mit starkem Nationalstolz, besitzt ein modernes Militär und wird vom Ausland unterstützt. Aber es braucht eben auch die Fähigkeit eines Individuums, die Führungsrolle zu übernehmen. So war auch Putin lange der starke Mann an der Spitze Russland, aber jetzt wirkt er mehr und mehr isoliert.
Wie zeigt sich das?
Will man ihn treffen, muss man mehrere Covid-Tests machen, er hält Abstand zu allen, was zu absurden Fotos eines einsamen Mannes an einem überdimensionalen Tisch führt. Sein Beraterkreis wird immer kleiner. Es ist wie bei allen Diktatoren: Sie begeben sich in eine Blase, in der sie nur noch das zu hören bekommen, was sie wollen. Das führt zu schrecklichen Fehlern, wie Putin ihn mit der Invasion der Ukraine begangen hat.
«Die Lügen der russischen Propagandamaschine werden immer absurder.»
Was lernt man aus der neusten Vergangenheit über Putin?
In Tschetschenien, Georgien und Syrien haben russische Kämpfer Städte in Schutt und Asche zurückgelassen. Aus der Ukraine erreichen uns nun Bilder, die aussehen wie die Fotos der Zerstörung von Aleppo. Aufgrund der angewendeten Gewalt hat Putin das Gegenteil erreicht von dem, was er wollte: Die ukrainische Bevölkerung will unter keinen Umständen zu Russland gehören.
Was bedeutet das für den weiteren Verlauf des Konflikts?
Die wohl beste Lösung ist ein Waffenstillstand, aber dazu müsste Russland zu Verhandlungen bereit sein und die Truppen aus weiten Teilen der Ukraine abziehen. Die Krim und die sogenannt unabhängigen Donbass-Republiken würden dabei wahrscheinlich an Russland übergehen. Zudem dürfte die Ukraine niemals der Nato beitreten. Aber wenn Sie Ukrainerin wären, würden Sie Putin noch glauben?
Wahrscheinlich nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten als einen Waffenstillstand?
Auf der einen Seite steht ein Eingriff der Grossmächte in den Konflikt, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil dann mehrere Staaten mit Nuklearwaffen aktiv gegeneinander kämpfen würden. Ein anderes Extrem ist ein Coup gegen Putin. Doch da diese beiden Szenarien eher unwahrscheinlich sind, bleiben Verhandlungen der beste Weg.
Und wenn sie scheitern?
Dann wird die Ukraine weiter zerstört. Aber selbst wenn sich die Ukrainer ergeben sollten und die Regierung ins Exil geht: Die Russen müssten viele Besatzungstruppen im Land stationieren, denn die Ukrainer werden sich nicht einfach so unterwerfen.
Wie beeinflusst die Liveschaltung des Krieges in die Welt die Geschehnisse vor Ort?
Information war schon immer ein Kriegsinstrument. Im Ersten Weltkrieg versuchte man mit Flugblättern und Artikeln in der neutralen Presse – unter anderem in der Schweiz – hinter die feindlichen Linien zu kommen. Im Zweiten Weltkrieg war die Technik der Wahl das Radio – das jetzt von der BBC wieder eingesetzt wird, um die russischen Hörer zu erreichen. Doch die Informationstechnologie der Stunde sind die sozialen Medien, und diese weiss die Ukraine besser zu bespielen als Russland.
Aber wie steht es um die Information der russischen Bevölkerung?
Für den Moment kontrolliert der Kreml die Medienlandschaft, aber es fragt sich, wie lange noch. Das Internet ermöglicht die Umgehung staatlicher Verbote. Zudem: Erfolgreiche Propaganda enthält immer auch einen Kern Wahrheit. Und die Lügen der russischen Propagandamaschine werden immer absurder. Zuerst waren die Ukrainer Nazis, dann Drogenabhängige, jetzt seien sie daran, Nuklearwaffen zu entwickeln. Die Ukraine hat ihr Atomwaffenprogramm bereits in den Neunzigern aufgegeben.
Was bezweckt Putin damit?
Er will die eigene Bevölkerung überzeugen, dass sie auf der richtigen Seite des Konflikts stehen. Aber je länger dieser anhält, desto schwieriger wird es, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten. Das hat der Kampf der Sowjets in Afghanistan gezeigt, irgendwann beginnen die Angehörigen der gefallenen Soldaten, Fragen zu stellen, sie können nicht alle in Verkehrsunfällen gestorben sein. Und auch wenn akkurate Zahlen in einem Krieg immer schwierig zu verifizieren sind, ist davon auszugehen, dass bereits gleich viele oder sogar mehr russische Soldaten in der Ukraine ums Leben gekommen sind als damals in Afghanistan.
Wie gross ist das Risiko, dass andere Staaten dem russischen Beispiel folgen?
Gross. Die Liste der potenziellen Krisenherde ist lang: China und Taiwan, Indien und Pakistan, afrikanische Grenzen, die den jeweiligen Herrschern ein Dorn im Auge sind. Wenn Putin ungestraft davonkommt, wird sein Vorgehen von anderen Despoten nachgeahmt werden. Als Hitler in den Dreissigerjahren nicht gestoppt wurde, bestätigte das Mussolini in seinen Expansionsplänen.
Welche Rolle spielen Atomwaffen?
Sie machen alle Beteiligten vorsichtiger, aber gleichzeitig vervielfachen sie auch die Gefahr einer Eskalation. Zudem werden immer mehr Staaten als «Absicherung» selbst Atomwaffen haben wollen, Japan und Polen könnten die nächsten Nuklearstaaten sein.
Die Welt ist nicht friedlicher geworden.
Einige Teile der Welt sind definitiv friedlicher geworden, nehmen Sie Ihr eigenes Land: Schweizer Söldner waren bis ins siebzehnte Jahrhundert gefürchtet in ganz Europa für ihre Stärke und Brutalität. Und heute ist die Schweiz ein Synonym für Frieden und Stabilität.
Historiker wie Steven Pinker, die argumentieren, dass der allgemeine Trend weg von Gewalt hin zu mehr Frieden gehe, haben also doch recht?
Nur teilweise, denn diese Theorien waren immer sehr auf den Westen fokussiert. Grosse Teile der Welt kamen nie in den Genuss des «langen Friedens», wie die Zeit nach 1945 auch bezeichnet wird. Es gibt auch Studien der Universitäten Florenz und Colorado, wonach die immer engere Verknüpfung der Gesellschaften Konflikte schneller eskalieren lässt und wir weniger, aber dafür todbringendere Kriege sehen. Viele Gesellschaften sind friedlicher geworden seit 1945, aber wir dürfen die zahlreichen Aufstände und Bürgerkriege nicht vergessen. Was jedoch seit dem Zweiten Weltkrieg abgenommen hat, sind Kriege zwischen souveränen Staaten, weshalb der Krieg in der Ukraine so bemerkenswert ist.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.