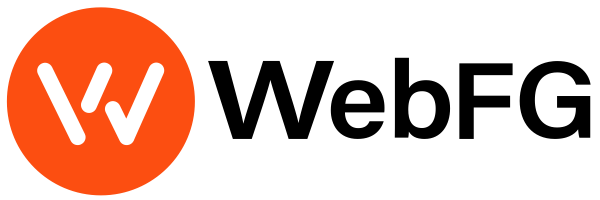News
Schuldentragbarkeit in sehr unsicheren Zeiten
Die Fiskalpolitik sollte aufhören, sich auf optimistische Wirtschaftsszenarien zu verlassen – und akzeptieren, dass Haushaltsdefizite abgebaut werden müssen, sobald die Inflation eingedämmt ist. Ein Kommentar von Charles Wyplosz.
Seit geraumer Zeit wird das Thema Staatsverschuldung jeweils vor allem mit Blick auf die Schuldentragfähigkeitsanalyse betrachtet. Sowohl internationale Institutionen und nationale Regierungen als auch Finanzunternehmen nutzen dieses Instrument, das die Entwicklung der Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP) in den kommenden Jahren vorhersagt. Auf den ersten Blick eine einfache buchhalterische Übung, um die Tragfähigkeit von Schulden zu beurteilen.
Einfach ist es aber nicht: Die Vorhersage künftiger Schuldenquoten erfordert Prognosen zur Entwicklung der Zinsen, des BIP-Wachstums und des Primärhaushaltssaldos Jahr für Jahr. Dabei gilt es, Jahrzehnte in die Zukunft zu blicken. Selbst mehrere Jahre mit grossen Defiziten – wie die meisten Länder sie in letzter Zeit erlebt haben – bedeuten nicht zwingend, dass die Verschuldung untragbar geworden ist. Entscheidend ist, wie sich der Staatshaushalt, aber auch die Zinsen und das Wirtschaftswachstum über eine lange Frist entwickeln.
Bei der Frage nach der Tragbarkeit geht es um die Zukunft, deshalb steht und fällt jede Schuldentragbarkeitsanalyse mit den Prognosen. Wirtschaftsprognosen allerdings können sehr unzuverlässig sein, vor allem wenn sie weit in die Zukunft blicken.
Nicht auf historische Trends abstützen
In der guten alten Zeit der grossen Mässigung galt dieser Ansatz nicht als abwegig. Es schien plausibel, sich auf historische Trends zu stützen. Aus dieser Zeit stammen zwei beliebte Doktrinen. Die erste lautet, dass der Gleichgewichtszins, also der Zins, bei dem die Inflation unter sonst gleichen Umständen stabil bleibt, niedrig, möglicherweise gar negativ ist. Die zweite – bekannt als r-g – besagt, dass das BIP-Wachstum (g, Growth) wenn nicht auf unbestimmte Zeit, so doch sehr lange höher sein wird als der Zins (r, Rate). Ist dies der Fall, kann man beruhigt davon ausgehen, dass Staatsschulden sich mehr als selbst finanzieren.
Bei Annahme eines vernünftigen Szenarios für die künftigen primären Haushaltsdefizite gelten die meisten öffentlichen Schuldenquoten deshalb als tragbar, zumindest in den entwickelten Volkswirtschaften. Gelegentliche hohe Defizite sind kein Problem, sofern sie nicht zu lange andauern. Doch wie robust sind diese Doktrinen in der heutigen Welt, die von vielen Krisen geprägt ist? Der erste wichtige Wachstumstreiber, die Demografie, spricht eher für eine weniger expandierende Wirtschaft. Ein weiterer Treiber, die Investitionen in die Produktionskapazität, lässt sich bloss schätzen.
Der dritte Treiber, die Produktivität, bleibt rätselhaft: Zwar ist überall von IT- und Robotikrevolution die Rede, doch die Auswirkungen auf die Produktivität müssen sich erst noch einstellen. In den entwickelten Volkswirtschaften werden überwiegend Dienstleistungen produziert, in diesem Bereich geht technologischer Fortschritt nur langsam vonstatten. Die Globalisierung hat dank Spezialisierung in der Industrie zu Produktivitätsgewinnen beigetragen, dies könnte sich nun auch auf Dienstleistungen auswirken. Doch bisher hat sich das Wachstum nicht beschleunigt, und nun wird schon von Deglobalisierung gemunkelt.
Dann die Zinsen: Im Kampf gegen die Inflation setzen Zentralbanken die Zinsen hinauf. Von ihrer Annahme, der Inflationsschub sei nur temporär, sind sie abgerückt. Doch wie lange wird die Teuerung erhöht bleiben? Gemäss den Notenbanken wird schon eine moderate Anhebung der Zinsen auf, sagen wir, 3% die Inflation schnell eindämmen.
Bei Inflationsraten von 5% oder mehr bleibt das (nominale) BIP-Wachstum über dem (nominalen) Zins, selbst wenn es zu einer kleinen Rezession kommt. Dieses optimistische Szenario geht davon aus, dass der reale Gleichgewichtszins strukturell sehr niedrig ist, sodass wir schliesslich zu niedrigen Zinsen zurückkehren und die Tragfähigkeit der Schulden nicht gefährdet ist.
Fragil und rätselhaft
Doch was, wenn die Inflation sich als hartnäckig erweist? Vor der grossen Mässigung war es zur Eindämmung der Inflation nötig, den Zins dauerhaft weit über die Inflationsrate zu hieven, was häufig eine Konjunkturabschwächung, wenn nicht gar eine Rezession auslöste. In diesem pessimistischen Szenario steigt die Staatsverschuldung rasch und kann instabil werden, wenn im Haushalt nicht bald ein Überschuss hergestellt wird.
Über den realen Gleichgewichtszins wissen wir leider erstaunlich wenig. Immer wieder sind Erklärungen aufgekommen, warum er dermassen niedrig ist. Zunächst wurde es der Hypothese der Sparschwemme zugeschrieben, der Idee, dass die weltweiten Ersparnisse zugenommen haben, während die Investitionsausgaben zurückgegangen sind. Es stimmt, dass China zu einem grossen Sparer geworden war. Doch das war vor etwa zehn Jahren, heute gilt es nicht mehr. Danach wurden die hohen Ersparnisse mit der Alterung der Bevölkerung begründet – ein fragiler Zusammenhang.
Dann wiederum hiess es, Investitionen seien dank technischem Fortschritt billiger geworden. Letztlich ist diese Sichtweise wohl deshalb so populär, weil sie belegt, warum die Inflation seit 2008 so niedrig geblieben ist – weil die Zentralbanken die Leitzinsen nicht weit genug senken konnten. Doch das ist bestenfalls ein Indizienbeweis. Die Vernunft drängt die Einsicht auf, dass das Niveau des Gleichgewichtszinses ebenso rätselhaft bleibt wie die wahrscheinliche Entwicklung des Wirtschaftswachstums.
Unter diesen Umständen ist jede Politik, die sich auf die Analyse der Schuldentragbarkeit stützt, heikel, wenn nicht irreführend. Neu wäre das nicht: Seit 2008 ist das Wirtschaftswachstum höher als die Zinsen, die Schuldenquoten hätten sinken müssen. In vielen Ländern ist aber das nicht geschehen, die Haushaltsdefizite blieben zu hoch.
Ein Grund ist, dass die Regierungen zahlreiche unerwartete Schocks bewältigen mussten. Möglich ist auch, dass die Regierungen angesichts optimistischer Szenarien zum Schluss gekommen sind, sie könnten Haushaltsdefizite fahren, ohne sich um die Schuldentragfähigkeit sorgen zu müssen.
Haushaltdefizite steigen
Ist die Inflation erst einmal unter Kontrolle, wird die Tragbarkeit der Schulden zum nächsten grossen Problem der Politik. Schon jetzt ist die Staatsverschuldung auf einem hohen Niveau. Nun sehen wir uns mit einem ausserordentlichen Mix an wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die die Haushaltsdefizite vergrössern. Die Pandemie und der Ukrainekrieg verlangen nach mehr Staatsausgaben für Gesundheit und Verteidigung. Die Ungleichheit nimmt zu und wird wohl durch mehr Transfers und vielleicht niedrigere Steuern bekämpft werden müssen.
Und der Klimawandel bedeutet eine Herausforderung gänzlich neuen Ausmasses. Klimapolitische Massnahmen erfordern substanzielle zusätzliche Ausgaben, mit Transfers an die weniger Wohlhabenden im eigenen Land ebenso wie an ärmere Staaten, die wenig zur Umweltverschmutzung beitragen, aber heftig unter deren Folgen leiden, die sie allein nicht bewältigen können. Erschwerend kommt hinzu, dass all diese Massnahmen das Wirtschaftswachstum belasten werden – womit wir uns noch weiter von der komfortablen Lage entfernen, in der das Wachstum die Zinsen übersteigt.
Die Prognosen im Rahmen der Schuldentragbarkeitsbetrachtung sind mehr als nur wackelig, aber die Logik der Analyse an sich ist unbestreitbar. Wir sollten aufhören, uns auf optimistische Szenarien zu verlassen, und akzeptieren, dass Haushaltsdefizite abgebaut werden müssen, sobald die Inflation eingedämmt ist. Nicht auf einen Schlag, aber schrittweise und stetig, sofern kein weiterer Schock eintritt. Wie die Geldpolitik in ihren glorreichen Zeiten sollte die Fiskalpolitik in Zukunft nicht auf Dogmen beruhen, sondern auf einer sorgfältigen Einschätzung der aktuellen und der künftigen Bedingungen.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.