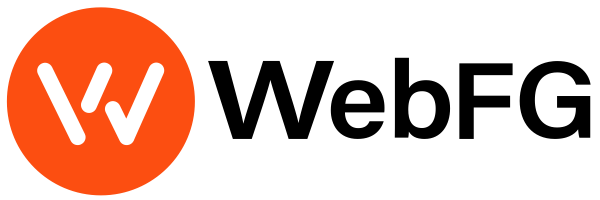News
Den Subventionsdschungel roden
Die Schweiz leidet an chronischer Subventionitis. Es mangelt an Transparenz und Bremsmechanismen. Ein Kommentar von FuW-Redaktor Arno Schmocker.
Die Sozialistische Partei der Schweiz (SP) führt noch immer die Überwindung des Kapitalismus in ihrem Programm. Sie kämpft gegen ein Phantom. 2020 hat der Bund zwei von drei Franken in Form einer Subvention ausgegeben.
Gemäss einer Studie von Avenir Suisse sind die Bundessubventionen in den vergangenen fünf Jahrzehnten inflationsbereinigt um das Sechsfache gestiegen. Wegen der Coronabeihilfen hat sich die Summe 2020 sprunghaft 14 Mrd. auf etwa 57 Mrd. Fr. erhöht.
Einen grossen Teil der zusätzlichen 14 Mrd. Fr. hat der Bund als Entschädigung für Kurzarbeit ausgezahlt. Dass er soziale Härten abgefedert und Arbeitsplätze erhalten hat, war in einer solch ausserordentlichen Situation wie der Pandemie sinnvoll.
Es würde jedoch keineswegs überraschen, wenn 2 bis 3 Mrd. Fr. Unterstützung etwa für den Tourismus sowie Kunst und Kultur «kleben» blieben – einmal eingeführte Subventionen pflegen sich, wie Steuern, quasi zu verewigen. Von der Politik, mitnichten nur auf der linken Seite, werden sie oft für die Förderung von Partikularinteressen eingesetzt. Zu den Subventionen werden nicht nur Direktzahlungen gerechnet, sondern auch staatliche Garantien (etwa für Kantonalbanken), Bürgschaften sowie Zins- und Steuervergünstigungen.
Eine freie Marktwirtschaft beruht auf einer möglichst klaren Aufteilung von Staat und Markt. Subventionen schwächen indessen die Abwehr gegen einen überbordenden Staat. Die Folgewirkungen werden oft unterschätzt.
Staatliche Eingriffe in private Märkte führen oft zu Folgeinterventionen und verhindern, dass sich Empfänger der Wohltaten rasch an sich verändernde Marktverhältnisse anpassen. Zur Kehrseite von Subventionen zählen nicht nur Protektionismus und Strukturerhaltung, sondern auch Marktverzerrungen und sogenannte Mitnahmeeffekte: Investitionen, zum Beispiel in Wärmepumpen, würden zu einem grossen Teil auch ohne Subventionen gemacht.
Darüber hinaus sind sie unfair. Wenige profitieren, die Zeche bezahlt die Allgemeinheit. Im Zusammenhang mit Subventionen wäre es ein kleiner Schritt in Richtung Transparenz, nicht vom Staat als Wohltäter und Almosengeber zu sprechen, sondern vom Tax Payer, vom Steuerzahler, wie dies im angelsächsischen Sprachraum eher üblich ist.
Was tun gegen das Dickicht der Subventionen? Avenir Suisse schlägt als ersten Reformschritt, gleichsam als «Mindestmassnahme», vor, mehr Transparenz zu schaffen über Umfang, Sinn und Zweck einer Beihilfe. Nicht nur beim Bund, sondern besonders auch in den Kantonen und den Gemeinden: Peter Grünenfelder, Direktor des liberalen Think Tank, nennt sie eine «finanzpolitische Dunkelkammer». Mehr Transparenz würde den disziplinierenden Druck erhöhen.
Zudem wären Subventionen von einer unabhängigen Instanz auf Wettbewerbsverzerrungen hin zu prüfen. Auch das müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Schwieriger durchzubringen wäre, eine Art Verfallsdatum für Subventionen einzuführen; ohne parlamentarische Bestätigung würden sie automatisch eingestellt.
Ein wirksames Gegenmittel gegen die grassierende Subventionitis wäre sodann das Prinzip, für jede neue Subvention Beihilfen in ähnlichem Umfang abzuschaffen. Als Vorlage könnte die Schuldenbremse dienen, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Schweiz die finanziellen Folgen der Coronakrise problemlos schultern konnte.
Der Weckruf von Avenir Suisse kommt zur richtigen Zeit. Aus liberaler Sicht hat sich ein grosser Reformbedarf aufgestaut. Die Coronamassnahmen könnten zu einem dauerhaft höheren Grad an Kollektivismus führen. In der Energiepolitik will man die Wende mit enormen Beihilfen – fast 12 Mrd. Fr. für den Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 – herbeisubventionieren.
Es wird sich zudem weisen müssen, ob alle betroffenen Kantone der Verlockung widerstehen, die bevorstehende Umsetzung der globalen OECD-Mindeststeuer mit dem süssen Gift staatlicher Unterstützungsleistungen zu kompensieren. In einer liberalen Marktwirtschaft haben Subventionen genau genommen nichts zu suchen.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.