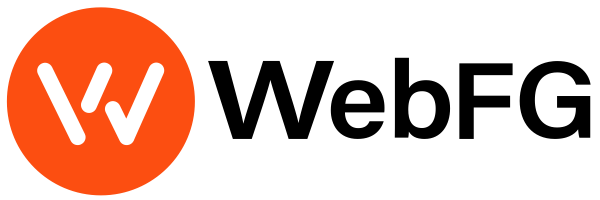News
Was Schindlers ewiger Konkurrent richtig macht
Wie Schindlers finnischer Konkurrent Kone den Aufzugsmarkt umkrempelt und die Krise in China meistern will. Auf Besuch in Hyvinkää.
In Hyvinkää, knapp eine Autostunde von der finnischen Hauptstadt Helsinki entfernt, ist der Name Kone jedem geläufig. In den von Birkenwäldern umringten Werkhallen am Stadtrand arbeiten knapp 1200 Leute für den Lifthersteller. Die Betontürme, quasi Teststrecken für neue Lifte, sind bis ins Stadtzentrum sichtbar. Kone betrieb lange ein Geschäft mit Industriekränen, das 1993 abgestossen wurde. Seitdem hat sich das Unternehmen, sehr erfolgreich, auf das Geschäft mit Aufzügen konzentriert. Zahlreiche Brancheninnovationen gehen auf die Finnen zurück.
Beim Schweizer Lifthersteller Schindler kennt man die Finnen als harten Konkurrenten, aber auf Augenhöhe. In beiden Unternehmen sind die Gründerfamilien Ankeraktionäre, beide Unternehmen sind mit ca. 60’000 Mitarbeitern in etwa gleich gross. Kone baut wie Schindler in der obersten Liga, mit Liften für das Leadenhall Building in London und den Citic Tower, das höchste Gebäude Pekings.
Kone ist allerdings profitabler und am Heimatmarkt eine Grösse für sich. Während in Schweden die Technikabsolventen am liebsten zu Google wollen, steht in Finnland der Name Kone in den Rankings für den Wunscharbeitgeber an erster Stelle. Sogar die SBB verbauten in Zürich jüngst lieber Rolltreppen und Aufzüge von Kone anstatt von Schindler. Die Finnen machen etwas richtig, aber was? In Hyvinkää findet man ein paar Antworten.
Markt in China schrumpft
In Hyvinkää werden vor allem die Lifte gefertigt, die nicht unbedingt Standard sind – solche, die auf Kreuzfahrtschiffen eingebaut werden oder in Luxushotels in Dubai. Beim Rundgang durch das Werk zeigt Manager Timo Luotonen auf eine Liftkabine, die im Stil eines Jaguarinterieurs gefertigt wurde. Könnte man einen Lift nur aus Holz fertigen? «Eigentlich schon, zumindest bis auf die Tragtechnik», findet Luotonen.
Vor der Massenfertigung kommen öfter Architekten und Gebäudetechniker auf Kontrollbesuch nach Hyvinkää. Auf dem Jaguar-Lift wurden zahlreiche gelbe Sticker angebracht. «Das sind die beanstandeten Mängel» erklärt Luotonen. Auch wenn hier viel Handarbeit ist: Manche Elemente der Liftkabine werden vollautomatisch gefertigt. In knapp dreissig Minuten ist eine Liftwand durch Industrieroboter gestanzt, vernietet, verklebt und als Flachware verpackt wie ein Ikea-Paket.
Lifthersteller sind eine eingeschworene Gemeinde. Der weltweite Markt für die vertikale Beförderung ist überschaubar, und konzentriert sich im Wesentlichen auf vier Hersteller: Otis, Kone, ThyssenKrupp und Schindler – ein De-Facto-Oligopol, das über Jahrzehnte den weltweiten Liftmarkt kontrollierte.
Die Übernahme der Liftsparte von Thyssenkrupp durch die Private-Equity-Firmen Cinven und Advent im Jahr 2020 löste ein kleines Erdbeben aus, das nur von den jüngsten Sorgen um das Chinageschäft übertroffen wurde. In den vergangenen Jahren war die chinesische Nachfrage nach Liften nämlich mit Abstand am höchsten – jedoch ging die Bautätigkeit in den vergangenen Monaten zweistellig zurück.
Servicegeschäft entscheidend
Auch für Kone ist China der wichtigste Markt, die Finnen verbauen dort zwei Drittel ihrer Neuinstallationen. Dass das Neubaugeschäft dieses Jahr dort noch zu retten sein wird, glaubt in der Branche keiner mehr – Kone selbst geht von einer Kontraktion um 10% aus. Zu den aus anderen Branchen bekannten Problemen der Lieferkette und den jüngsten Lockdowns kommt im Liftgeschäft auch noch ein spezifisches Problem der Immobilienentwickler, namentlich eine Liquiditätskrise. «Die Regierung hat der Finanzierung von Wohnungen in China Restriktionen auferlegt, um Risiko aus dem Markt zu nehmen», erklärt Henrik Ehrnrooth, CEO von Kone. «Diese werden nun langsam gelockert.»
«Die Regierung hat der Finanzierung von Wohnungen in China Restriktionen auferlegt, um Risiko aus dem Markt zu nehmen.»
Durch die Bauflaute in China wird das traditionell wichtige Servicegeschäft zum alles entscheidenden Wachstumstreiber: Lifte müssen schliesslich modernisiert und gewartet werden. Gegenüber den anderen Mitbewerbern Schindler, Otis und ThyssenKrupp hat Kone in China mit knapp 19% Marktanteil die grösste Zahl installierter Einheiten und schöpft somit aus dem Vollen. Nicht automatisch geht aber ein Produkt der Marke mit dem Servicevertrag desselben Anbieters einher, auch wenn Kone eine vergleichsweise hohe Kundenbindung hat.
«Wir haben eine etwas andere Strategie als unsere Wettbewerber», erklärt Ehrnrooth. «Wir vergrössern das Instandhaltungsgeschäft über neu gewonnene Serviceverträge, aber auch über digitale Dienste.»
Lifte mit allem verbinden
Dass Lifte digitaler werden, ist an keinem Unternehmen der Branche spurlos vorbeigegangen. Viele der in den europäischen Altbauten eingesetzten Fahrstühle operieren zwar heute noch mit telefonischem Notruf, wohingegen die neueste Generation der Lifte 24/7 elektronisch überwacht wird und jede noch so kurze Unterbrechung im Idealfall bereits vorher erkannt wird. Kone testet derzeit, womit man einen Lift sinnvoll digital verknüpfen kann.
Die Finnen experimentieren mit Reinigungsrobotern, die Lifte drahtlos bedienen und so eigenständig ganze Hochhäuser reinigen. Eine spezifisch für Blinde entwickelte App zeigt diesen an, wo und auf welcher Höhe sich ein Lift befindet. Mit der SBB gibt es ein Pilotprojekt, bei dem die Lifte mit der digitalen Kone-Plattform vernetzt sind, sodass nicht nur SBB-Ingenieure sehen, ob eine Anlage läuft oder steht, sondern auch die Benutzer per App, die ihre Reise entsprechen planen können.
Ob das der Grund ist für die höheren Margen im Vergleich zu Schindler? Dazu will sich auch CEO Ehrnrooth nicht äussern. «Wir sind ja auch in etwas anderen Märkten», meint er vorsichtig.
Auch sonst macht Kone aber einiges richtig. Kones Vorschlag, während der Bauzeit von Häusern Lifte zum Transport von Baumaterialien einzusetzen, ermöglicht den chinesischen Immobilienriesen Zeit und Energiekosten des Aufbaus signifikant zu verkürzen. Dass Kone die CO2-Emissionen pro Produkt und Komponente misst, hilft zwar in Europa, ist in China für Modernisierungaufträge am privaten Wohnungsmarkt abseits der Prestigeprojekte vielleicht noch zu wenig relevant.
Vertikalität ausser Frage
Kones Werkstatt ist ein Indikator, wohin sich die Branche in Zukunft bewegen wird. Lifte werden nicht nur nachhaltiger und vernetzter, sondern auch immer mehr zum Multimediaerlebnis. In Kones neuester Flaggschiffliftserie, der vor knapp einem Jahr lancierten DX Class, ist die gesamte Rückwand ein riesiger Bildschirm. Kones neue Liftkabinen können je nach erreichtem Stockwerk die Farbe und Tonalität wechseln — vom Partylift zum multimedialen Stadtführer mit Internetanbindung.
Kone-Manager Teppo Voutilainen, kann sich vorstellen, dass Lifte bald den Musikgeschmack jedes Liftgasts kennen und automatisch entsprechende Musik auflegen. Denkbar ist, dass das Geschäftsmodell von Fahrstühlen irgendwann sogar nach Verfügbarkeit oder auf Transaktionen basiert. «Jede Liftfahrt wird irgendwann vielleicht per Mikrotoken bezahlt – wer die Treppe nimmt, muss nicht zahlen», so Voutilainen lachend. Ganz utopisch klingt das nicht.
«Das grösste Risiko ist es, momentan nicht in China zu sein»
Am Ende des Tages wird einem bei einem Besuch bei den Liftbauern in Hyvinkää aber vor allem klar, dass bei allem technologischen Fortschritt sich am Konzept des vertikalen Transports so bald nichts ändern dürfte. Das bestätigt auch Research-Chefin Amy Chen. Der Lift als solches ist zu sehr an das Modell der Stadt an sich geknüpft. Menschen ziehen selbst nach der Coronazeit noch immer in die Städte, dort wiederum ist der Platz knapp. Man muss also in die Höhe bauen.
An der Börse haben sowohl Kone wie auch Schindler im vergangenen Jahr Kurskorrekturen von über einem Viertel des Börsenwerts erlitten. CEO Ehrnrooth ist trotzdem optimistisch. «Die Marktumgebung ist auf jeden Fall in China herausfordernd. Gleichzeitig befinden wir uns in einer Industrie, in der sich beim Thema Nachhaltigkeit sehr viel tut.» Bleibt nur noch die Frage, wie man das Servicegeschäft schneller ausbaut, als das Neugeschäft derzeit schrumpft. «Das grösste Risiko ist es, momentan nicht in China zu sein», findet er.
Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.